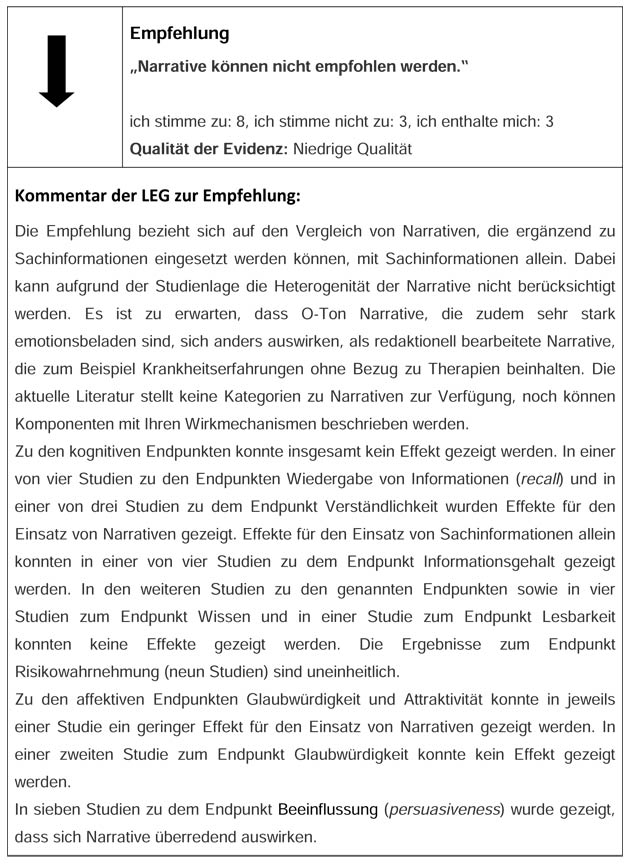 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Ergebnisse
Zu diesem Vergleich wurden 18 Studien mit insgesamt 10226 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschlossen. Die Teilnehmerzahlen lagen zwischen 31 und 2506 und das mittlere Alter je nach Zielgruppe zwischen 20 und 72 Jahren. Die Studien wurden in den USA (5, 12-22), den Niederlanden (23), Australien (24), Großbritannien (25), Italien (26) und Deutschland (27, 28) durchgeführt. Eingeschlossen wurden Studierende (14, 18, 20, 24, 25, 27), zufällig ausgewählte Probandinnen und Probanden (13, 20, 22, 28), Patientinnen und Patienten (16) sowie spezielle Zielgruppen, insbesondere für Screening- und Präventionsthemen (5, 12, 15, 17, 19, 23, 26). Die Interventionen bestanden aus Videos, Internetseiten oder Informationsbroschüren zu Screening, Prävention oder gesunder Lebensführung (5, 12, 14, 15, 19-21, 24), Impfungen (23, 26-28), zu Therapieoptionen (13, 22, 25) und Generika (20). Zwei Studien untersuchten die Therapieadhärenz (16, 17) und eine die Wirkung von Sicherheitswarnungen (18).
Zu den Endpunkten Wissen und Lesbarkeit konnte kein Effekt gezeigt werden. Wissen wurde anhand von Tests mit neun, 22 oder 24 Items erhoben. Sie umfassten Multiple Choice Fragen und die Bewertung von Aussagen mit falsch / richtig (5) (16) (19). Eine Studie nutzte die modifizierter Version eines bestehenden Wissenstest (24). Es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen mit Narrativen und denen mit Sachinformationen gezeigt (5, 16, 19, 24). Die Lesbarkeit wurde in einer Studie als Kovariable untersucht, ohne einen Effekt nachzuweisen (18). Es wurde eine automatische Berechnung des Schwierigkeitslevels durchgeführt.
Zu den Endpunkten Wiedergabe von Informationen (recall), Verständlichkeit, Informationsgehalt und Risikowahrnehmung konnte kein eindeutiger Effekt für oder gegen den Einsatz von Narrativen gezeigt werden. Die Wiedergabe von Informationen wurde anhand einer bzw. vier offener Fragen zu Inhalten der Informationen (z.B. Symptome, Risiken oder Empfehlungen) erhoben (12, 15, 17, 20). In einer Studie wurde zusätzlich nach der stärksten Erinnerung gefragt (12). In drei Studien wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen mit Narrativen und denen mit Sachinformationen gezeigt (12, 17, 20). In einer Studie wurde ein geringer Effekt für den Einsatz von Narrativen gezeigt (15).
Die Verständlichkeit der Information wurde jeweils anhand von zwei bzw. drei Items subjektiv auf Likert-Skalen eingeschätzt (14, 21, 26). In zwei Studien wurde kein Effekt nachgewiesen (14, 21). In einer Studie wurde ein geringer Effekt für den Einsatz von Narrativen gezeigt (26). Der Informationsgehalt der Informationen wurde jeweils anhand von ein bis drei Items subjektiv auf Likert-Skalen eingeschätzt (14, 15, 19, 20). In drei Studien wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen gezeigt (15, 19, 20). In einer Studie wurde ein geringer Effekt für den Einsatz statistischer Darstellungen gezeigt (14).
Die Risikowahrnehmung wurde in Form von Selbsteinschätzungen erhoben (5, 14, 15, 23, 24, 26-28). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gebeten, ihr eigenes Risiko auf Likert-Skalen einzuschätzen, teilweise im Vergleich zu anderen Personen. Es wurden zwischen einem und elf Items abgefragt. Nur in zwei Studien wurde das tatsächliche Risiko als Vergleichsgröße herangezogen (27, 28). Die Anzahl positiver / negativer Narrative kann die Risikowahrnehmung im Vergleich zum tatsächlichen Risiko verändern (27). Ein relevanter Effekt auf die Einschätzung des eigenen Risikos lässt sich insgesamt nicht nachweisen. In 6 Studien wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen mit Narrativen und denen mit Sachinformationen gezeigt. In zwei Studien wird das Risiko mit Narrativen höher eingeschätzt (5, 28). In einer Studie wird das Risiko mit statistischen Informationen höher eingeschätzt (14).
Zu den Endpunkten Attraktivität und Glaubwürdigkeit wurden geringe Effekte für den Einsatz von Narrativen gezeigt. Glaubwürdigkeit und Attraktivität wurden anhand von einem bzw. zwei Items subjektiv auf Likert-Skalen eingeschätzt (15, 21, 26). Eine Studie hat die Attraktivität untersucht und dabei einen geringen Effekt für den Einsatz von Narrativen gefunden (15). In einer Studie zum Endpunkt Glaubwürdigkeit wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen mit Narrativen und denen mit Sachinformationen gezeigt (21). In einer zweiten Studie wurde ein geringer Effekt für Narrative gezeigt (26).
Zu dem Endpunkt Beeinflussung / Überzeugung (persuasiveness) konnte in allen eingeschlossenen Arbeiten ein Effekt nachgewiesen werden (13, 19, 20, 22, 25, 27, 28). Statistische Angaben können durch Narrative verzerrt werden (13, 22, 27, 28). Wird die Anzahl der positiven und negativen Narrative proportional zu den statistischen Daten gewählt oder diese unterstützend durch Piktogramme dargestellt, verringert sich der Einfluss der Narrative (13, 22, 27, 28). Der Endpunkt Beeinflussung wurde anhand von (hypothetischen) Entscheidungen bzw. Absichten für oder gegen eine Intervention erhoben (13, 22, 25, 27, 28). In zwei Studien wurde persuasiveness mittels eines Scores (fünf, sieben oder zehn Items, u.a. zum geplanten Verhalten, subjektive Einschätzung auf Likert-Skalen) ermittelt (19, 20). Der Endpunkt informierte Entscheidung wird bisher nicht einbezogen. Insgesamt konnte zum aktuellen Zeitpunkt kein relevanter Nutzen durch ergänzende Narrative in Gesundheitsinformationen nachgewiesen werden. Das Risiko, dass Narrative eine überredende Wirkung entwickeln, wird als hoch angesehen. Der Einsatz von Narrativen ist daher nicht mit den Zielen von EBPI vereinbar.
Weitere Informationen zu den Ergebnissen und Erhebungsmethoden können den Evidenztabellen und den Zusammenfassungen der Studien (study fact sheets) entnommen werden.
Forschungsbedarf
Zurzeit laufen Studien, die den Aspekt „persuasiveness“ weiter untersuchen. Das heißt, in naher Zukunft können Studienergebnisse vorliegen, die diese Empfehlung verändern könnten.
